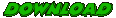|
| Deutsch |
| Fachoberschule - Technik |
|
 |
|
Prüfungen
|
|
| Prüfungshinweise für die Prüfungsteilnehmer/-innen |
|
- Einlesezeit: 30 Minuten
- Arbeitszeit: 240 Minuten
- Hilfsmittel : Duden
|
|
|
| Prüfung |
 |
Aufgabe 1 Freie Erörterung
"Wer Selbstverwirklichung im vollen Umfang will, muss auf Kinder verzichten. Kinder zu haben, ist immer eine Einschränkung der Selbstverwirklichung - jedenfalls in dem Verständnis, wie es heute weithin herrscht. Ich bin der Meinung, dass es richtig verstanden anders ist, dass also gerade Kinder geradezu zur Selbstentfaltung einen wesentlichen Beitrag leisten."
(Steffen Heitmann, Justizminister des Freistaates Sachsen, in:
Süddeutsche Zeitung v. 18.9.1993)
Erörtern Sie die Problematik und entwickeln Sie Ihre Vorstellungen von Selbstverwirklichung!
(Dem Aufsatz muß eine Gliederung vorangestellt werden.)
|
Aufgabe 2 Erörterung eines Sachtextes
Michael Schwarze: Eine ernste Sache
Analysieren Sie den vorliegenden Text und setzen Sie sich mit der darin enthaltenen Problematik auseinander!
|
Aufgabe 3 Interpretation eines epischen Textes
Sybille Berg (geb. 1962): Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot
Interpretieren Sie den Textausschnitt!
|
Aufgabe 4 Interpretation eines dramatischen Textes
Friedrich Dürrenmatt (1921 -1990): Der Besuch der alten Dame
Interpretieren Sie den Dramenauszug!
|
|
 |
 |
Textanhang zu Aufgabe 2 |
 |
|
Michael Schwarze
Eine ernste Sache
Kulturpessimisten haben der Menschheit schon vor Jahrzehnten eine gewisse Rastlosigkeit bescheinigt. Sie konnten freilich beim besten Willen nicht ahnen, dass einmal die Mehrzahl der Menschen damit beschäftigt sein würde, einen Ball zu treten, zu werfen oder ihn mittels eines darmsaitenbespannten Ovals über ein Netz zu schlagen.
Ein antiquierter Mensch ist heute zu nennen, wer in seinem Keller nicht mindestens einen Expander, eine Sprossenwand und ein Standfahrrad sein eigen nennt. Gelinde gesagt nicht auf dem Laufenden ist jener, dem ein Dynamik-Trainer und ein Laufband-Ergometer fehlen. Die Ruhe ist nicht länger erste Bürgerpflicht, Bewegungslosigkeit gilt als Missetat am Körper, als perfider Anschlag auf die Gesundheit, auf Herz, Kreislauf und den Stoffwechsel. Wer länger leben will, muss länger laufen. Der Bewegungszwang äußert sich anfangs eher harmlos. Der Aufzug bleibt unbenutzt, der Mensch erklimmt die Treppen. Einmal der Bewegungshilfen entwöhnt, die böse Techniker zum Schaden des Wohlbefindens ersonnen haben, strebt der Mensch nach mehr. Dies war die Geburtsstunde des "Jogging". Das lang anhaltende Traben hatte unter dem alten deutschen Wort Dauerlauf ein unscheinbares Dasein gefristet: auch verriet das deutsche Wort noch zu viel von der relativen Ödnis dieser Beschäftigung. Als Import hat es seinen Siegeszug angetreten. Wer auf sich hält, läuft schon längst nicht mehr vor der Haustür. Er fliegt freitags nach New York, hetzt samstags zweiundvierzig Kilometer durch die frischgelüfteten Straßen der Stadt und kehrt sonntags mit dem beruhigenden Gefühl zurück, seinem Körper Gutes getan zu haben, während der Nachbar bei Kaffee und Kuchen auf dem Balkon der Gesundheit Schaden zugefügt hat. 25 Millionen lauffreudiger Zeitgenossen soll es allein in den Vereinigten Staaten geben. Destruktive Engerlinge haben gelegentlich vor den schädlichen Folgen dieses Dauerlaufs gewarnt. Doch wie sollte man eine Menschheit, der man das Rauchen nicht abgewöhnen kann, vor der Gesundheit warnen können. Keine Frage, wir sind Augenzeuge einer Gesundheitsepidermie. Jeder schnorchelt heute so gut er kann, steht mit zwei Beinen auf einem Rollschuh oder wirft einen Ball mit erstaunlicher Ausdauer an die Wand, um ihn beim Rückf lug wieder zu erhaschen. Die Epidemie spart niemanden aus. Nicht die Jungen, nicht die Alten, nicht hoch, nicht niedrig. Wo in der fitnesslosen alten Zeit zwei würdige Herren im gemessenen Tempo einander im Park begegneten, artig den Hut lüfteten, eilen sie heute aneinander vorbei, allenfalls zum Gruße die Trainingsjahre lupfend ...
Die Sportmanie wird man rückhaltlos bejahen können. Sportfreunde haben sich immer etwas zu sagen. Wo die Gespräche zwischen gewöhnlichen Menschen leicht ins Stocken geraten und eine unangenehme Stille aufkommt, braucht der Gastgeber um Gesprächsstoff für seine Bekannten aus dem Tennisklub nicht besorgt zu sein. Immerzu kommen neue Schläger auf den Markt, die Mode muss bedacht werden und auch der beklagenswerte Zustand - des Klubhauses. Wie nichts sonst entspricht der Bewegungsdrang auch dem Selbstbild einer mobilen Gesellschaft. Geschwindigkeit ist alles. Die Industriegesellschaften haben den historischen Sprung geschafft. Sie sind umstandslos vom Fortschritt zum Fortlauf übergegangen.
Sport nannte man einst die herrlichste Nebensache der Welt. Darin lag unangemessene Geringschätzung. Manche nahmen die Mitgliedschaft im Handballverein nur als Vorwand für Zechgelage. Mit diesem Unernst hat es ein Ende. Vor längerer Zeit führte ein Mitbürger ein Fernsehteam nicht ohne Stolz in seine gute Stube. Die Wände waren übersät mit Plaketten, die der Mann in penibler Kleinarbeit bei Hunderten von Volksläufen redlich erworben hatte. Spaß ist Spaß und Sport ist Dienst. Der sportliche Trieb hüllt sich in mancherlei Gewand. Eines ist jene Art zu tanzen, wie sie heute in Diskotheken zu beobachten ist. War früher der Tanz ein mühsamer Umweg in dem Bemühen, einen Menschen anderen Geschlechts kennen zu lernen, so ähnelt er heute der Körpergymnastik. Stürzte früher, sobald die Musik nur etwas schleppend wurde, alles auf die Tanzfläche, so leert sich diese heutzutage schlagartig, wenn langsame Rhythmen den potentiellen Fitnesswert des Tanzes zu vermindern drohen. Sportlich aussehen ist alles. Früher hätte sich ein Angestellter geschämt, mit sonnengebräuntem Gesicht seine Ärmelschoner abzuwetzen. Schließlich hätte das bedeutet, er habe zuviel freie Zeit. Heute will jeder so aussehen, als sei er das ganze Jahr im Urlaub. Wem kein Lauf zu lang, kein Berg zu hoch, kein Brett zu dünn, kein Weg zu weit ist, den belohnt die Statistik. Fast vier Jahre, so lockten die Zahlen, lebt ein Dauerläufer länger. Hernach wird man sagen:
Laufe in Frieden.
(Aus: Schwarze, Michael: Eine ernste Sache. FHRP 1991. In ders., Weihnachten ohne Fernsehen, Frankfurt 1984, S. 98 - 100)
|
| |
 |
Textanhang zu Aufgabe 3 |
 |
|
Sybille Berg
Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot - Nora hat Hunger -
Ich wiege mich jeden Morgen.
Morgens ist es immer ein bißchen weniger.
Seit einem halben Jahr esse ich nur noch Gurken, Äpfel und Salat. Alles ohne Zusätze, versteht sich.
Zuerst war mir übel. Ich hatte Bauchkrämpfe. Aber jetzt geht es einfach. Wenn ich Essen rieche, habe ich keinen Hunger mehr. Mir wird direkt schlecht, wenn ich Essen rieche.
Gestern waren es 40 Kilo. Ich bin 1,75 groß. Vielleicht wachse ich noch. Dünner werde ich auf jeden Fall.
Ich habe es mir geschworen.
Seit ich nicht mehr esse, brauche ich niemanden mehr. Meine Eltern sind fremde Personen geworden. Es ist mir egal, ob sie mich beachten oder nicht. Ich bin sehr stark. Meine Mutter hat geweint, neulich. Ich habe zugesehen, wie das Wasser ihr Make up verschmiert hat. Und bin rausgegangen. Es sah häßlich aus. Ich habe auch gesehen, wie dick sie ist. Sie sollte etwas dagegen tun. Ich verstecke mich in der Schule nicht mehr. Als ich noch dick war, bin ich in der Pause immer aufs Klo gegangen, damit sie mich nicht ignorieren können. Jetzt stehe ich offen da und denke mal, daß sie mich beneiden.
Ich sehe noch immer nicht ganz schön aus. Ich bin noch zu dick. Die Arme sind gut, da ist kaum noch Fleisch dran. Ich finde Fleisch häßlich. Und die Rippen sieht man auch schon gut. Aber die Beine sind zu dick.
Als ich noch richtig dick war, hatte ich irgendwie keine Persönlichkeit. Jetzt ist das anders. Ich bin innen so wie außen. Ganz fest. Mit einem Ziel ist keiner alleine, weil ja dann neben dem Menschen immer noch das Ziel da ist. Ich kann mich noch erinnern, wie es war, dick zu sein. Mal ging es mir gut, und im nächsten Moment mußte ich heulen und wußte nicht, warum. Ich meine, das kam mir alles so sinnlos vor. Daß ich bald mit der Schule fertig bin und dann irgendeinen Beruf lernen muß. Und dann würde ich heiraten und würde in einer kleinen Wohnung wohnen und so. Das ist doch zum Kotzen. Mit so einer kleinen Wohnung, meine ich. Das kann doch nicht Leben sein. Aber eben, wie Leben sein soll, das weiß ich nicht. Ich denke mir, daß ich das weiß, wenn ich schön bin. Ich werde so schön wie Kate Moss oder so jemand. Vielleicht werde ich Model.
Meine Mutter war mit mir bei einem Psychologen. Ein dicker, alter Mann. Mutter ließ uns allein, und er versuchte mich zu verarschen. Mich verarscht keiner so leicht. Ich hab so einiges gelesen, ich meine, ich kenne ihre blöden Tricks. Und der Typ war mal speziell blöd.
"Bedrückt dich was", hat er gefragt. Und so ein Scheiß halt, und ich habe ihn die ganze Zeit nur angesehen. Der Mann war echt fett, und unter seinem Hemd waren so Schwitzränder. Ich habe nicht über eine Fragen nachgedacht.
Ich meine, was soll ich einem fremden, dicken Mann irgendwas erzählen. Einem Mann, der sich selbst nicht unter Kontrolle hat. Der frißt. Ich bin weggegangen und habe den Psychologen sofort vergessen.
Ich habe ein Ziel.
Ich habe vor nichts mehr Angst. Ich denke nicht mehr nach. Das ist das Beste.
(Aus: Berg, Sybille: Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Reclam-Verlag, Leipzig 1997, S. 9 - 10)
|
|
|
 |
Textanhang zu Aufgabe 4 |
 |
|
Friedrich Dürrenmatt
Der Besuch der alten Dame
Die Milliardärin Claire Zachanassian kehrt nach Jahren in ihre Heimatstadt Güllen zurück, aus der sie einst verstoßen wurde. Sie bietet den Einwohnern eine Milliarde für den Mord an ihrer Jugendliebe Alfred III, der sie einst schwanger sitzen ließ, um eine wohlhabendere Frau zu heiraten. Dem verlockenden Angebot können die hochverschuldeten Güllener schließlich nicht widerstehen und schreiten zur Tat. In der vorliegenden Szene des l. Aktes stellt Claire Zachanassian erstmalig ihre Forderung.
CLAIRE ZACHANASSIAN Bürgermeister, Güllener. Eure selbstlose Freude über meinen Besuch rührt mich. Ich war war ein etwas anderes Kind, als ich nun in der Rede des Bürgermeisters vorkomme, in der Schule wurde ich geprügelt, und die Kartoffeln für die Witwe Boll habe ich gestohlen, gemeinsam mit III, nicht um die alte Kupplerin vor dem Hungertode zu bewahren, sondern um mit III einmal in einem Bett zu liegen, wo es bequemer war als im Konradsweilerwald oder in der Peterschen Scheune. Um jedoch meinen Beitrag an eure Freude zu leisten, will ich gleich erklären, daß ich bereit bin, Güllen eine Milliarde zu schenken. Fünfhundert Millionen der Stadt und fünfhundert Millionen verteilt auf alle Familien.
Totenstille
DER BÜRGERMEISTER stotternd Eine Milliarde.
Alle immer noch in Erstarrung.
CLAIRE ZACHANASSIAN Unter einer Bedingung.
Alle brechen in einen unbeschreiblichen Jubel aus. Tanzen herum, stehen auf die (l) Stühle, der Turner turnt usw. III trommelt sich begeistert auf die Brust.
ILL Die Klara! Goldig! Wunderbar! Zum Kugeln! Voll und ganz
mein Zauberhexchen! Er küßt sie.
DER BÜRGERMEISTER Unter einer Bedingung, haben gnädige Frau gesagt. Darf ich diese Bedingung wissen?
CLAIRE ZACHANASSIAN Ich will die Bedingung nennen. Ich gebe euch eine Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit.
Totenstille.
DER BÜRGERMEISTER Wie ist dies zu verstehen, gnädige Frau?
CLAIRE ZACHANASSIAN Wie ich es sagte.
DER BÜRGERMEISTER Die Gerechtigkeit kann man doch nicht kaufen!
CLAIRE ZACHANASSIAN Man kann alles kaufen.
DER BÜRGERMEISTER Ich verstehe immer noch nicht.
CLAIRE ZACHANASSIAN Tritt vor, Boby.
Der Butler tritt von rechts in die Mitte zwischen die drei Tische, zieht die dunkle Brille ab.
DER BUTLER Ich weiß nicht, ob mich noch jemand von euch erkennt.
DER LEHRER Der Oberrichter Hofer.
DER BUTLER Richtig. Der Oberrichter Hofer. Ich war vor fünfundvierzig Jahren Oberrichter in Güllen und kam dann ins Kaffiger Appellationsgericht, bis mir vor nun fünfundzwanzig Jahren Frau Zachanassian das Angebot machte, als Butler in ihre Dienste zu treten. Ich habe angenommen. Eine für einen Akademiker vielleicht etwas seltsame Karriere, doch die angebotene Besoldung war derart phantastisch -
CLAIRE ZACHANASSIAN Komm zum Fall, Boby.
DER BUTLER Wie ihr vernommen habt, bietet Frau Claire Zachanassian eine Milliarde und will dafür Gerechtigkeit. Mit anderen Worten: Frau Claire Zachanassian bietet eine Milliarde, wenn ihr das Unrecht wiedergutmacht, das Frau Zachanassian in Güllen angetan wurde. Herr III, darf ich bitten.
III steht auf, bleich, gleichzeitig erschrocken und verwundert.
ILL Was wollen Sie von mir?
DER BUTLER Treten Sie vor, Herr III.
ILL Bitte. Er tritt vor den Tisch rechts. Lacht verlegen. Zuckt die Achseln.
DER BUTLER Es war im Jahre 1910. Ich war Oberrichter in Güllen und hatte eine Vaterschaftsklage zu behandeln. Claire Zachanassian, damals Klara Wäscher, klagte Sie, Herr III, an, der Vater ihres Kindes zu sein.
/// schweigt.
DER BUTLER Sie bestritten damals die Vaterschaft, Herr III. Sie hatten zwei Zeugen mitgebracht.
ILL Alte Geschichten. Ich war jung und unbesonnen.
CLAIRE ZACHANASSIAN Führt Koby und Loby vor, Toby und Roby.
Die beiden kaugummikauenden Monstren führen die beiden blinden Eunuchen, die sich fröhlich an der Hand halten, in die Mitte der Bühne.
DIE BEIDEN Wir sind zur Stelle, wir sind zur Stelle!
DER BUTLER Erkennen Sie die beiden, Herr III.
III schweigt.
DIE BEIDEN Wir sind Koby und Loby, wir sind Koby und Loby. ILL Ich kenne sie nicht.
DIE BEIDEN Wir haben uns verändert, wir haben uns verändert.
DER BUTLER Nennt eure Namen.
DER ERSTE Jakob Hühnlein, Jakob Hühnlein.
DER ZWEITE Ludwig Sparr, Ludwig Sparr.
DER BUTLER Nun, Herr III.
ILL Ich weiß nichts von ihnen.
DER BUTLER Jakob Hühnlein und Ludwig Sparr, kennt ihr Herrn III?
DIE BEIDEN Wir sind blind, wir sind blind.
DER BUTLER Kennt ihr ihn an seiner Stimme?
DIE BEIDEN An seiner Stimme, an seiner Stimme.
DER BUTLER 1910 war ich der Richter und ihr die Zeugen. Was habt ihr geschworen, Ludwig Sparr und Jakob Hühnlein, vor dem Gericht zu Güllen?
DIE BEIDEN Wir hätten mit Klara geschlafen, wir hätten mit Klara geschlafen.
DER BUTLER So habt ihr vor mir geschworen. Vor dem Gericht, vor Gott. War dies die Wahrheit?
DIE BEIDEN Wir haben falsch geschworen, wir haben falsch geschworen.
DER BUTLER Warum, Ludwig Sparr und Jakob Hühnlein?
DIE BEIDEN III hat uns bestochen, III hat uns bestochen.
DER BUTLER Womit?
DIE BEIDEN Mit einem Liter Schnaps, mit einem Liter Schnaps.
CLAIRE ZACHANASSIAN Erzählt nun, was ich mit euch getan habe, Koby und Loby.
DER BUTLER Erzählt es.
DIE BEIDEN Die Dame ließ uns suchen, die Dame ließ uns suchen.
DER BUTLER So ist es. Claire Zachanassian ließ euch suchen. In der ganzen Welt. Jakob Hühnlein war nach Kanada ausgewandert und Ludwig Sparr nach Australien. Aber sie fand euch. Was hat sie dann mit euch getan?
DIE BEIDEN Sie gab uns Toby und Roby. Sie gab uns Toby und Roby.
DER BUTLER Und was haben Toby und Roby mit euch gemacht?
DIE BEIDEN Kastriert und geblendet, kastriert und geblendet.
DER BUTLER Die ist die Geschichte: Ein Richter, ein Angeklagter, zwei falsche Zeugen, ein Fehlurteil im Jahre 1910. Ist es nicht so, Klägerin?
Claire Zachanassian steht auf.
ILL stampft auf den Boden. Verjährt, alles verjährt. Eine alte, verrückte Geschichte.
DER BUTLER Was geschah mit dem Kind, Klägerin?
CLAIRE ZACHANASSIAN leise Es lebte ein Jahr.
DER BUTLER Was geschah mit Ihnen?
CLAIRE ZACHANASSIAN Ich wurde eine Dirne.
DER BUTLER Weshalb?
CLAIRE ZACHANASSIAN Das Urteil des Gerichts machte mich dazu.
DER BUTLER Und nun wollen Sie Gerechtigkeit, Claire Zachanassian?
CLAIRE ZACHANASSIAN Ich kann sie mir leisten. Eine Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred III tötet.
Totenstille.
FRAU ILL stürzt auf III zu, umklammert ihn Fredi!
ILL Zauberhexchen! Das kannst du doch nicht fordern! Das Leben ging doch längst weiter!
CLAIRE ZACHANASSIAN Das Leben ging weiter, aber ich habe nichts vergessen, III. Weder den Konradsweilerwald noch die Petersche Scheune, weder die Schlafkammer der Witwe Boll noch deinen Verrat. Nun sind wir alt geworden, beide, du verkommen und ich von den Messern der Chirurgen
zerfleischt, und jetzt will ich, daß wir abrechnen, beide: Du hast dein Leben gewählt und mich in das meine gezwungen. Du wolltest, daß die Zeit aufgehoben würde, eben, im Wald unserer Jugend, voll von Vergänglichkeit. Nun habe ich sie aufgehoben, und nun will ich Gerechtigkeit, Gerechtigkeit für eine Milliarde.
Der Bürgermeister steht auf, bleich, würdig.
DER BÜRGERMEISTER Frau Zachanassian: Noch sind wir in Europa, noch sind wir keine Heiden. Ich lehne im Namen der Stadt Güllen das Angebot ab. Im Namen der Menschlichkeit. Lieber bleiben wir arm denn blutbefleckt.
Riesiger Beifall.
CLAIRE ZACHANASSIAN Ich warte.
(Dürrenmatt, Friedrich: Der Besuch der alten Dame. In: Dürrenmatt, Friedrich: Gesammelte Werke, Stücke 1. Diogenes Verlag AG, Zürich 1996, S. 606 - 612)
|
|
|
| Prüfung |
 |
Aufgabe 1 Freie Erörterung
"Die Größte Schwäche der Gewalt liegt darin, dass sie gerade das erzeugt, was sie vernichten will. Statt das Böse zu verringern, vermehrt sie es [...] Durch Gewalt kann man den Hasser ermorden, aber man tötet den Hass nicht. Das ist der Lauf der Dinge. Gewalt mit Gewalt zu vergelten, vermehrt die Gewalt und macht eine Nacht, die schon sternenlos ist, noch dunkler."
(Martin Luther King, Black Power. In: Wohin führt unser Weg?, Düsseldorf 1968)
Erörtern Sie die Problematik und formulieren Sie Ihre Vorstellungen dazu, ob eine Gesellschaft ohne Gewalt existieren kann!
(Dem Aufsatz muss eine Gliederung vorangestellt werden.)
|
Aufgabe 2 Erörterung eines Sachtextes
Max Frisch: Homo faber (Auszug)
Untersuchen Sie die Argumentationsstruktur des Autors! Setzen Sie sich mit der Problematik auseinander und entwickeln Sie Ihre eigene Position dazu.
|
Aufgabe 3 Interpretation eines epischen Textes
Helga Königsdorf (geb. 1936): Unverhoffter Besuch
Interpretieren Sie den Text!
|
Aufgabe 4 Interpretation eines dramatischen Textes
Walter Hasenclever (1890-1940): Der Sohn (II. Akt, 2. Szene)
Interpretieren Sie den Dramenauszug!
Untersuchen Sie dabei die unterschiedlichsten Positionen von Vater und Sohn.
Bewerten Sie diese aus Ihrer Sicht!
|
|
 |
 |
Textanhang zu Aufgabe 2 |
 |
|
Max Frisch
Homo faber (Auszug)
Schwangerschaftsunterbrechung ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Grundsätzlich betrachtet: Wo kämen wir hin ohne Schwangerschaftsunter brechungen? Fortschritt in Medizin und Technik nötigen gerade den verantwortungsbewußten Menschen zu neuen Maßnahmen. Verdreifachung der Menschheit in einem Jahrhundert: Früher keine Hygiene. Zeugen und gebären und im ersten Jahr sterben lassen, wie es der Natur gefällt, das ist primitiver, aber nicht ethischer. Kampf gegen das Kindbettfieber. Kaiserschnitt, Brutkasten für Frühgeburten. Wir nehmen das Leben ernster als früher. Johann Sebastian Bach hatte dreizehn Kinder (oder so etwas) in die Welt gestellt, und davon lebten nicht 50 %. Menschen sind keine Kaninchen, Konsequenz des Fortschritts: wir haben die Sache selbst zu regeln. Die drohende Überbevölkerung unserer Erde. Mein Oberarzt war in Nordafrika, er sagt wörtlich: Wenn die Araber eines Tages dazu kommen, ihre Notdurft nicht rings um ihr Haus zu verrichten, so ist mit einer Verdopplung der arabischen Bevölkerung innerhalb von zwanzig Jahren zu rechnen. Wie die Natur es überall macht: Überproduktion, um die Erhaltung der Art sicherzustellen. Wir haben andere Mittel, um die Erhaltung der Art sicherzustellen. Heiligkeit des Lebens! Die natürliche Überproduktion (wenn wir drauflosgebären wie die Tiere) wird zur Katastrophe: nicht Erhaltung der Art, sondern Vernichtung der Art. Wieviel Menschen ernährt die Erde? Steigerung ist möglich, Aufgabe der Unesco: Industrialisierung der unterentwickelten Gebiete, aber die Steigerung ist nicht unbegrenzt. Politik vor ganz neuen Problemen. Ein Blick auf die Statistik: Rückgang der Tuberkulose beispielsweise, Erfolg der Prophylaxe, Rückgang von 30 % auf 8 %. Der liebe Gott! Er machte es mit Seuchen; wir
haben ihm die Seuchen aus der Hand genommen. Folge davon: wir müssen ihm auch die Fortpflanzung aus der Hand nehmen. Kein Anlaß zu Gewissensbissen, im Gegenteil: Würde des Menschen, vernünftig zu handeln und selbst zu entscheiden. Wenn nicht, so ersetzen wir die Seuchen durch Krieg. Schluß mit Romantik. Wer die Schwangerschaftsunterbrechung grundsätzlich ablehnt, ist romantisch und unverantwortlich. Es sollte nicht aus Leichtsinn geschehen, das ist klar, aber grundsätzlich: wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, beispielsweise der Tatsache, daß die Existenz der Menschheit nicht zuletzt eine Rohstoff Frage ist. Unfug der staatlichen Geburtenforderung in faschistischen Ländern, aber auch in Frankreich. Frage des Lebensraumes. Nicht zu vergessen die Automation: wir brauchen gar nicht mehr so viele Leute. Es wäre gescheiter, Lebensstandard zu heben. Alles andere führt zum Krieg und zur totalen Vernichtung. Unwissenheit. Unsachlichkeit noch immer sehr verbreitet. Es sind immer die Moralisten, die das meiste. Unheil anrichten, Schwangerschaftsunterbrechung: eine Konsequenz der Kultur, nur der Dschungel gebärt und verwest, wie die Natur will. Der Mensch plant. Viel Unglück aus Romantik, die Unmenge katastrophaler Ehen, die aus bloßer Angst vor Schwangerschaftsunterbrechung geschlossen werden heute noch. Unterschied zwischen Verhütung und Eingriff? In jedem Fall ist es ein menschlicher Wille, kein Kind zu haben. Wieviele Kinder sind wirklich gewollt? Etwas anderes ist es, daß die Frau eher will, wenn es einmal da ist. Automatismus der Instinkte, sie vergißt, daß sie es hat vermeiden wollen, dazu das Gefühl der Macht gegenüber dem Mann, Mutterschaft als wirtschaftliches Kampfmittel der Frau. Was heißt Schicksal? Es ist lächerlich, Schicksal abzuleiten aus mechanisch-physiologischen Zufällen, es ist eines modernen Menschen nicht würdig. Kinder sind etwas, was wir wollen, beziehungsweise nicht wollen. Schädigung der Frau? Physiologisch jedenfalls nicht, wenn nicht Eingriff durch Pfuscher; psychisch nur insofern, als die betroffene Person von moralischen oder religiösen Vorstellungen beherrscht wird. Was wir ablehnen; Natur als Götze! Dann müßte man schon konsequent sein; dann auch kein Penicillin, keine Blitzableiter, keine Brille, kein DDT, kein Radar und so weiter. Wir leben technisch, der Mensch als Beherrscher der Natur, der Mensch als Ingenieur, und wer dagegen redet, der soll auch keine Brücke benutzen, die nicht die Natur gebaut hat. Dann müßte man schon konsequent sein und jeden Eingriff ablehnen, das heißt: sterben an jeder Blinddarmentzündung. Weil Schicksal! Dann auch keine Glühbirne, keinen Motor, keine Atom-Energie, keine Rechenmaschine, keine Narkose - dann los in den Dschungel!
Frisch. Max: Homo faber. Ein Bericht. Suhrkamp Taschenbuch 354, S. 105-107
|
|
|
 |
Textanhang zu Aufgabe 3 |
 |
|
Helga Königsdorf
Unverhoffter Besuch
Freitagabend kommt Britt. Unangemeldet. Unerwartet. Ungelegen. Und fragt: Ich störe doch nicht?
Ich bin kein Mensch, den man unangemeldet besucht. Jedenfalls tut es sonst niemand, auch Gustav nicht. Freitag ist sein Abend.
Britt hinterläßt ihre Schuhe im Flur, legt ihre Beine über die Armlehne meines Drehsessels und schwingt langsam her und hin.
Um nicht reden zu müssen - wie oft habe ich Gespräche falsch begonnen - um also nichts zu verderben, beschäftige ich mich mit lauter Nebensächlichkeiten. Zünde Kerzen an. Streiche Kissen glatt. Ziehe Vorhänge zu. Schenke Kirschlikör ein. Stullen hole ich später. Aber keinesfalls bevor Britt sagt: Hab ich einen Hunger.
Als sich Britt eine von Gustavs Zigaretten aus der Schrankwand langt, weiß ich sie in nachsichtiger Stimmung. Sie hat Verständnis für mich, die ich in einer Erwachsenenwelt leben muß. Ahnt schon, mehr und mehr selbst betroffen, daß sich die Grenzen nicht weiten, sondern verengen.
Sie verzeiht mir, ehe ich noch daran denke. Beobachtet mich ein wenig spöttisch, wie ich den schwarzen Hörer aufnehme, die Nummer wähle und sage: Birgit Ellen ist bei mir. Macht euch keine Sorgen. Ich sage wirklich. Birgit Ellen. Mein Ton läßt keine Vertraulichkeiten zu. Keine Fragen. Keine Erklärungen. Britt sieht danach befriedigt aus und wird später von mir das Geld fiir die Rückfahrt annehmen. Insgeheim beneide ich sie. Ich bin niemals irgendwo davongelaufen. Ich wollte es immer allen recht machen.
Nun der Anruf bei Gustav. Diesen Abend bin ich nicht frei für ihn.
Wir schlürfen Kirschlikör, knabbern Anisplätzchen und mustern uns verstohlen. Ich registriere die struppigen Haare, den verwaschenen Pulli und die nicht sonderlich reinen Röhren ihrer Hosenbeine. Es ist ihre Art, Haltung zu zeigen, nicht anders als ich mit meinem Make up, dem Nagellack und dem Hauch Parfümduft. So sitzen wir da, beneiden einander und geben es nicht zu.
Britt besucht eine Spezialschule. Auf dem letzten Zeugnis hatte sie nur Einsen. Vom Sport ist sie durch Attests befreit. Sie läßt sich den Durchschnitt nicht verderben. Sie ist klein und mollig.
Ihr erster Freund war lang und mager. Manchmal wurde über sie gelacht, wenn sie nebeneinander gingen. Das hat er nicht ausgehalten. Das halten Männer nie aus.
Ihr zweiter Freund fand während seiner Armeezeit in Standortnähe eine andere. Britt spricht sachlich darüber. Dramen sind nicht modern. Vielleicht wäre es besser, sie könnte mal richtig heulen.
Ich habe mit meine Tragödien geleistet. Wandlungen vollzogen sich in mir. Schmerzhafte Wandlungen.
Britt sagt, sie sei glücklich, endlich die Pille ohne Einwilligung der Eltern nehmen zu dürfen. Ein Mädchen in ihrer Schule hat die zweite Unterbrechung hinter sich. Eine andere bekommt ein Kind. Wenn Britt ein Kind bekäme, könnte sie nicht studieren. Britt verträgt die Pille gut.
In Britts Alter bin ich manchmal mit dem Abendzug in die Kreisstadt gefahren und in der Dunkelheit lange ziellos durch menschenleere Straßen geirrt. In jener Zeit begann die Angst. Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Am Leben nicht teilzuhaben. Allein zu bleiben.
Auch Britt ist unruhig. Sie sehnt sich nach etwas und kann nicht sagen wonach. Hin und wieder überfällt sie eine grundlose Traurigkeit. Dann möchte sie sich am liebsten verkriechen. Eine ungeheure Begeisterungsfähigkeit liegt brach, weil sie dafür keine Verwendung weiß. Auf keinen Fall dürfte es organisiert werden, sagt Britt.
Ich hielt immer viel von Organisation. Ich hatte einen Lebensplan, und der ging auf. Der passende Mann. Im richtigen Jahr das richtige Kind. Wissenschaftliche Grade. Ein zunehmender Verantwortungsbereich. Ständig wachsende Bedürfnisse. Aber eines Tages, als es von mir hieß: Die hat
es geschafft, war alles wieder da. Das Gefühl, das Leben würde von anderen irgendwo anders gelebt. Die Einsamkeit. Viel trostloser jetzt, da ich
keinen Augenblick allein war. Die Angst, nicht zu genügen. Viel stärker jetzt, da ich scheinbar Erfolg um Erfolg verbuchte.
Britt kennt ihr Ziel noch nicht. Manchmal ist es, als kribbelten Ameisen in ihren Adem. Dann treibt es sie auf die Straße. Am Klubhaus hängt ein Schild: Jugendtanz fällt heute aus. Das Schild hängt bereits drei Monate. Mit Freundinnen besucht sie Kneipen und Tanzlokale. Von den Jungen,
die sie dort trifft, kennt sie oft nur die Spitznamen. Zuweilen finden sich mehrere zusammen, und sie fahren mit Motorrädern durch die umliegenden Dörfer. In solchen Augenblicken kann es geschehen, daß Britt ein helles Glück empfindet.
Ich wollte das Glück erzwingen. Ich habe alles zerschlagen, was sich mit meiner Unsicherheit, meiner Angst verband. Habe einen Scherbenhaufen hinterlassen und bin geflohen. Und mußte begreifen, daß ich nicht entfliehen konnte, weil ich alles in mir selbst trug.
Britts Eltern sind geschieden. Sie lebt bei ihrem Vater. Es war ihr eigener Wunsch. Jetzt kommt sie mit ihm immer schwerer aus, weil er nicht merkt, wie sehr sie schon sie selbst ist.
Man kommt gut allein zurecht, sage ich. Im Herbst werde ich für ein halbes Jahr nach M. fahren und eine Reihe von Vorträgen halten. Die werden ganz ordentlich, glaube ich. Vorher muß ich mir ein Kind wegmachen lassen.
Wir sehen uns an und sind begeistert. Jede ist es von sich. Und ich denke, daß es die einzige Art Selbstzufriedenheit ist, die ich mir erlauben will. Wenigstens zur Zeit. Bis ich gelernt habe, in mir selbst heimisch zu werden.
Im Herbst muß sich Britt endgültig für eine Studienrichtung entscheiden. Sie würde gern Staatsanwalt wie ihr Vater. Aber dafür nehmen sie keine Mädchen. Britt sieht das ein. Sie sieht auch ein, daß sie bei fast allen Bewerbungen bessere Leistungen vorweisen muß als ein Junge. Frauen sind unökonomisch, sagt Britt.
Sie hat sich noch nicht entschieden. Wir werden ständig orientiert, sagt Britt. Vor lauter Orientierungen hast du schließlich den Eindruck, alle anderen sind dafür verantwortlich, was aus dir wird, nur du selbst nicht.
Mit ihrem Vater kann sie darüber nicht reden. Jedes Gespräch mit ihm endet in der Feststellung, wie gut sie es habe, wie dankbar sie sein solle und daß sie es mit hohen Leistungen abgelten müsse. Es ist ein Automatismus, sagt Britt.
Weißt du noch, deine Aufziehpuppe, sage ich.
Ein bißchen ähneln alle Erwachsenen Aufziehpuppen, meint Britt und vergißt, wie nahe das Erwachsensein ist.
Britt ist nicht undankbar. Aber sie will auch nicht dauernd dankbar sein. Sie möchte etwas ganz Eigenes. Sie wird sich auf die Suche begeben und merken, daß die Suche nie aufhört.
Es klingelt. Britt, in Gustavs Schlafanzug, mit hochgerollten Hosenbeinen, öffnet die Tür. Gustav sagt: Habe ich das nötig. Er riecht nach Bier und Rauch. Wer bin ich denn. Ein Niemand. Ein Nichts. Einer, den man abbestellt wie eine Suppe, auf die man gerade mal keine Lust hat.
Britt meint, er habe recht, und wir sollten Kaffee kochen. Sie behandelt uns ein bißchen von oben herab. Gerade so, daß es wohltut. Offensichtlich leidet sie nicht an jenem Unterlegenheitsgefühl Männern gegenüber, das mir bereits mit der Muttermilch eingeflößt wurde. Sie braucht später ihre Unabhängigkeit nicht hinauszuschreien. Sie kann sich normal verhalten. In diesem Punkt jedenfalls.
Als wir mit dem Kaffee kommen, liegt Gustav auf dem Sofa und schnarcht.
Aus Matratzen und Kissen richten wir uns im Nebenzimmer auf dem Fußboden ein Lager. Ich halte Britt in den Armen, und wir flüstern noch eine Weile. Dann schläft sie ein, und ich liege ganz still, um sie nicht zu stören. Meine geliebte, geplante, verlorene Tochter Britt, die zu mir zurückgekehrt ist für diesen einen Augenblick.
Jugend in Deutschland - Ost und West. Diesterweg-Verlag, Frankfurt/M. 1991.S.104-108
|
|
|
 |
Textanhang zu Aufgabe 4 |
 |
|
Walter Hasenclever
Der Sohn (1914), 11/2
Der Sohn, der aus Protest gegen das Leistungsdenken des Vaters in der Schule durchgefallen ist, lebt wie ein Gefangener im elterlichen Haus. In der Szene 11/2 offenbart der Sohn dem Vater diese Tatsache.
DER SOHN geht ihm einen Schritt entgegen
Guten Abend, Papa!
DER VATER sieht ihn an, ohne ihm die Hand zu reichen, eine Weile
Was hast du mir zu sagen?
DER SOHN Ich habe mein Examen nicht bestanden.
Diese Sorge ist vorbei.
DER VATER Mehr weißt du nicht? Mußte ich deshalb zurückkehren?
DER SOHN Ich bat dich darum - denn ich möchte mit dir reden, Papa.
DER VATER So rede!
DER SOHN Ich sehe in deinen Augen die Miene des Schaffots. Ich fürchte, du wirst mich nicht verstehn.
DER VATER Erwartest du noch ein Geschenk von mir, weil sich die Faulheit gerächt hat?
DER SOHN Ich war nicht faul, Papa...
DER VATER geht zum Bücherschrank und wirft höhnisch die Bücher um
Anstatt diesen Unsinn zu lesen, solltest du lieber deine Vokabeln lernen. Aber ich weiß schon - Ausflüchte haben dir nie gefehlt. Immer sind Andere schuld. Was tust du den ganzen Tag? Du singst und deklamierst - sogar im Garten und noch abends im Bett. Wie lange willst du auf der Schulbank sitzen? All deine Freunde sind längst fort. Nur du bist der Tagedieb in meinem Haus.
DER SOHN geht hin zum Schrank und stellt die Bücher wieder auf
Dein Zorn galt Heinrich von Kleist; er berührt das Buch zärtlich der hat dir nichts getan. - Welchen Maßstab legst du an!
DER VATER Bist du schon Schiller oder Matkowski? Meinst du, ich hörte dich nicht? Aber diese Bücher und Bilder werden verschwinden. Auch auf deine Freunde werde ich ein Auge werfen. Das geht nicht so weiter. Ich habe kein Geld gespart, um dir vorwärts zu helfen; ich habe dir Lehrer gehalten und Stunden geben lassen. Du bist eine Schande für mich!
DER SOHN Was hab ich verbrochen? Hab ich Wechsel gefälscht?
DER VATER Laß diese Phrasen. Du wirst meine Strenge fühlen, da du auf meine Güte nicht hörst.
DER SOHN Papa, ich hatte anders gedacht, heute vor dir zu stehn. Fern von Güte und Strenge, auf jener Waage mit Männern, wo der Unterschied unseres Alters nicht mehr wiegt. Bitte, nimm mich ernst, denn ich weiß wohl, was ich sage! Du hast über meine Zukunft bestimmt. Ein Sessel blüht mir in Ehren auf einem Amtsgericht. Ich muß dir meine Ausgaben aufschreiben - ich weiß. Und die ewige Scheibe dieses Horizontes wird mich weiterkreisen, bis ich mich eines Tages versammeln darf zu meinen Vätern.
Ich gestehe, ich habe bis heute darüber nicht nachgedacht, denn die Spanne bis zum Ende meiner Schule erschien mir weiter als das ganze Leben. Nun aber bin ich durchgefallen - und ich begann zu sehn. Ich sah mehr als du, Papa, verzeih.
DER VATER Welche Sprache!
DER SOHN Eh du mich prügelst, bitte, hör mich zu Ende. Ich erinnre mich gut der Zeit, als du mich mit der Peitsche die griechische Grammatik gelehrt hast. Vor dem Schlaf im Nachthemd, da war mein Körper den Striemen näher! Ich weiß noch, wie du mich morgens überhörtest, kurz vor der Schule; in Angst und Verzweiflung mußt ich zu Hause lernen, wenn sie längst schon begonnen hatte. Wie oft hab ich mein Frühstück erbrochen, wenn ich blutig den langen Weg gerannt bin! Selbst die Lehrer hatten Mitleid und bestraften mich nicht mehr. Papa - ich habe alle Scham und Not ausgekostet. Und jetzt nimmst Du mir meine Bücher und meine Freunde, und in kein Theater darf ich gehen, zu keinem Menschen und in keine Stadt. Jetzt nimmst du mir von meinem Leben das Letzte und Ärmste, was ich noch habe.
DER VATER Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Sei froh, daß ich dich nicht längst aus dem Haus gejagt.
DER SOHN Hättest du es getan, ich wäre ein Stück mehr Mensch, als ich bin.
DER VATER Du bist noch mein Sohn, und ich muß die Verantwortung tragen. Was du später mit deinem Leben tust, geht mich nichts an. Heute habe ich zu sorgen, daß ein Mensch aus dir wird, der sein Brot verdient, der etwas leistet.
DER SOHN Ich keine deine Sorge, Papa! Du bewahrst mich vor der Welt, weil es zu deinem Zwecke geschieht! Aber wenn ich das Siegel dieser geistlosen Schule, die mich martert, am Ende auf meinem Antlitz trage, dann lieferst du mich aus, kalt, mit einem Tritt deiner Füße. 0, Verblendung, die du Verantwortung nennst! 0 Eigennutz, Väterlichkeit!
DER VATER Du weißt nicht, was du redest.
DER SOHN Und trotzdem will ich versuchen, noch heute in dieser Stunde, mit aller Kraft, der ich fähig bin, zu dir zu kommen. Was kann ich denn tun, daß du mir glaubst! Ich habe nur die Tränen meiner Kindheit, und ich fürchte, das rührt dich nicht. Gott, gib mir die Begeisterung, daß dein Herz ganz von meinem erfüllt sei!
DER VATER Jetzt antworte: was willst du von mir?
DER SOHN Ich bin ein Mensch, Papa, ein Geschöpf, ich bin nicht eisern, bin kein ewig glatter Kieselstein. Könnt ich dich erreichen auf der Erde! Könnt ich näher zu dir! Weshalb diese schmerzliche Feindschaft, dieser in Haß verwundete Blick? Gibt es ein Nest, einen Aufstieg zum Himmel - ich möchte mich an dich ketten - hilf mir!
Er fällt vor ihm nieder und ergreift seine Hand.
DER VATER entzieht sie ihm Steh auf und laß diese Mätzchen. Ich reiche meine Hand nicht einem Menschen, vor dem ich keine Achtung habe.
DER SOHN erhebt sich langsam Du verachtest mich - das ist dein Recht;
Dafür leb ich von deinem Gelde. Ich habe zum ersten Male die Grenzen des Sohnes durchbrochen mit dem Sturm meines Herzens. Sollt ich das nicht? Welches Gesetz zwingt mich denn unter dies Joch? Bist du nicht auch nur ein Mensch, und bin ich nicht deinesgleichen? Ich lag zu deinen Füßen und habe um deinen Segen gerungen, und du hast mich verlassen im höchsten Schmerz. Das ist deine Liebe zu mir. Hier endet mein Gefühl.
Hasenclever, Walter: Der Sohn. Reclam Universalbibliothek Nr. 8978, S. 35-38
|
|
|
| Prüfung |
 |
Aufgabe 1 Freie Erörterung
|
"Man will Geld verdienen, um glücklich zu leben, und die ganze Anstrengung, die beste Kraft eines Lebens konzentriert sich auf den Erwerb dieses Geldes. Das Glück wird vergessen, das Mittel wird Selbstzweck."
(Albert Camus)
Setzen Sie sich mit der Aussage Camus' auseinander! Überprüfen Sie die Gültigkeit dieser Auffassung für Ihre eigenen Wertvorstellungen!
(Dem Aufsatz muss eine Gliederung vorangestellt werden.)
|
Aufgabe 2 Erörterung eines Sachtextes
Bettina Gaus: Sollte irgendjemand meiner Tochter etwas antun ...
Untersuchen Sie die Argumentationsstruktur des Autors! Setzen Sie sich mit der Problematik auseinander und entwickeln Sie Ihre eigene Position dazu.
|
Aufgabe 3 Interpretation eines epischen Textes
Paul Schallück: Unser Eduard
Interpretieren Sie den Text! Gehen Sie dabei besonders auf die unterschiedlichen Sichtweisen bei der Charakterisierung Eduards ein!
|
Aufgabe 4 Interpretation eines dramatischen Textes
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781):
Nathan der Weise (II. Akt, 5. Szene)
Interpretieren Sie die Szene! Gehen Sie dabei besonders auf die Beziehung der Figuren und deren Entwicklung ein!
|
|
 |
 |
Textanhang zu Aufgabe 2 |
 |
|
Bettina Gaus: Sollte irgendjemand meiner Tochter etwas antun...
Anna ist zwölf. Als sie drei war, hat sie jeden Abend das Sandmännchen auf Video gesehen. Zwei Jahre später hörte sie in ihrem Zimmer diese unsäglich dämlichen Kassetten von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Heute findet Anna die Prinzen toll, schaut Viva und darf allein mit Freundinnen ins Kino gehen. Eine deutsche Kindheit. Allerdings eine nicht ausschließlich deutsche Kindheit. Annas Mutter ist gebürtige Münchenerin, ihr Vater ist Kenianer. Im Alter von eineinhalb Jahren ist sie mit ihren Eltern von Köln nach Nairobi gezogen. Beim Umzug nach Bonn war sie dann acht Jahre. Nun lebt sie seit einem Jahr in Berlin. Anna hat Wuschellocken und eine braune Hautfarbe.
Die Tochter steht Busfahrten etwas reserviert gegenüber und bittet die Mutter ungewöhnlich häufig, sie doch zum Basketball zu fahren. Eigentlich täte die Mutter das auch am liebsten. Und weiter?
Wenn eine Busfahrt im bürgerlichen Berliner Stadtteil Charlottenburg künftig zu den Dingen gehört, die man vorsichtshalber besser unterläßt, dann wird der Aktionsradius für eine Heranwachsende sehr eng. Also fährt die Mutter ihre Tochter nicht. Bloß nicht der Angst die Herrschaft über den Alltag überlassen.
Was ist unumgänglich, will man ein normales Leben führen, was in jedem Falle zu unterlassen, was vertretbar unter Abwägung aller Umstände? Menschen, die Anna lieben, sind gelegentlich geteilter Meinung hinsichtlich des möglichen Risikos, das mit einer Unternehmung verbunden ist. Es kommt zu Auseinandersetzungen, manchmal sogar zum Streit. Die Großeltern wollen nicht, dass Anna sie von Berlin aus allein in Hamburg mit der Eisenbahn besucht. Sie raten zum Flugzeug. Von Berlin nach Hamburg! Kommt ja überhaupt nicht in Frage! Die Mutter, die unter Flugangst leidet, lehnt kategorisch ab und erinnert ihre Eltern daran, wie sie selbst seinerzeit in diesem Alter ... und überhaupt. Natürlich ist sie nicht verantwortungslos. Aber von Pöbeleien in der ersten Klasse hört man doch eher selten. Anna selbst ist zwiegespalten. Einerseits will sie sehr gern einmal allein mit dem Zug fahren. Andererseits nähren solche Diskussionen Ängste. Übrigens bei allen Beteiligten. Wer könnte mit der Schuld leben, wenn ausgerechnet die Maschine, in der Anna sitzt, tatsächlich abstürzte - oder dem allein reisenden Kind in der Eisenbahn wirklich etwas zustieße? So holt denn die Großmutter ihre Enkelin mit dem Intercity ab. Morgens von Hamburg aus hin nach Berlin, mit dem Taxi zur Wohnung und mit dem nächsten Zug zurück. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Dieser Satz zieht sich wie ein Leitmotiv durchs Leben. Es ist auch für Menschen mit brauner Hautfarbe nicht besonders gefährlich, in Deutschland zu leben. Vorausgesetzt, sie passen ein bisschen auf. Wählen den richtigen Wohnort aus, verfügen über gute Einkommensverhältnisse, überprüfen die jeweilige Umgebung auf ihren Risikofaktor hin und verzichten gegebenenfalls auch mal auf einen Spaß. Viele derjenigen, die solche Überlegungen nicht anstellen müssen, halten das für durchaus zumutbar. Das Lebensglück hängt schließlich nicht vom Besuch eines Rummelplatzes ab. Nein, das Lebensglück nicht. Aber es geht nicht immer gleich um das Lebensglück.
Letzte Woche sei er an einem Badesee in Brandenburg gewesen, erzählt ein Freund. "Ich glaube, da könntest du mit Anna auch hingehen. Es waren sehr viele Leute da, und auf dem Parkplatz standen nur wenige Motorräder mit diesen rechtsradikalen Emblemen." Klingt relativ beruhigend. Die Mutter wählt ein Wochenende, an dem Anna eine andere Verabredung hat, und schaut sich den See einmal an. Wunderschönes, klares Wasser. Nett und freundlich aussehende Badegäste. Ein Boot wird gemietet. Es sind viele Boote unterwegs an diesem Tag, auch ein Kanu, auf dem einige Jugendliche sitzen. "Heil Hitler!", grölen sie.
Ein unglücklicher Zufall, sicher. Außerdem hätten sie Anna nichts getan, wäre sie dabei gewesen. Wie denn, mit fünf Meter Wasser dazwischen? Wahrscheinlich wären sie sogar an Land friedlich geblieben. Aber "wahrscheinlich" reicht nicht. Der See wird von der Liste möglicher Ausflugsorte gestrichen. Es gibt ja noch andere, die auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden können. Und hat Anna nicht sehr oft Glück gehabt? Durfte sie nicht Erfurt und Weimar besuchen, ohne dass ihr etwas Böses widerfahren wäre? Wird sie etwa in der Schule diskriminiert? Haben Eltern anderer Kinder je etwas gegen eine Freundschaft einzuwenden gehabt? Na also. Man soll die Situation von Minderheiten auch nicht dramatisieren.
Außerdem wird Ausländerfeindlichkeit doch zunehmend als Problem der Gesamtgesellschaft erkannt. Jedenfalls solange sich die Ausländer gut benehmen und sich nicht dorthin begeben, wo ihnen ihr gesunder Menschenverstand signalisieren müsste, dass sie in Gefahr geraten könnten. Aber was hat dieses Problem eigentlich mit Anna zu tun? Sie benötigte keine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, um so deutsch zu sein wie Helmut Kohl. Geboren in Nordrhein-Westfalen, deutsche Mutter, deutsche Schule, deutsches Leben. "Ich finde ja toll, wie akzentfrei du sprichst", sagt jemand. Anna, bei anderen Gelegenheiten für Lob nicht unempfänglich, reagiert eher verwirrt als geschmeichelt. "Wie soll ich denn sonst reden?" In der Tat - wie sonst?
In der Fernsehsendung "Sabine Christiansen" berichtet der brandenburgische Innenminister und CDU-Vorsitzende Jörg Schönbohm von einem Gespräch mit einigen Rechtsradikalen, bei dem es auch um das Thema Ausländerfeindlichkeit gegangen sei. Die Jugendlichen haben ihm erzählt, dass niemand mit ihnen rede und ihnen irgendetwas erkläre. Ach, so ist das. Diese Jugendlichen wissen einfach nicht, dass man Leute weder beleidigen noch bedrohen noch verprügeln noch umbringen sollte. Wenn ihnen das nur mal jemand sagen würde. Dann wäre das Problem quasi schon gelöst.
Diese Sätze von Schönbohm sind vollständig inakzeptabel. Man stelle sich vor, ein Vergewaltiger rechtfertigt sein Vergehen mit dem Hinweis, niemand habe ihm je erklärt, dass sich ein solches Verhalten nicht gehört. Ungläubige Empörung wäre die einzig vorstellbare Reaktion. Aber der Umgang mit Menschen, die anders aussehen als die Mehrzahl hierzulande, wird für außerordentlich schwierig gehalten. Niemand möchte sich dem Verdacht aussetzen, die Komplexität der Problematik nicht zu erkennen. Ich erkenne diese Komplexität nicht. Sollte irgendjemand meiner Tochter jemals irgendetwas antun, dann werde ich Arbeitslosigkeit, Kommunikationsprobleme und Existenzangst als Begründung dafür nicht akzeptieren. Ich glaube niemandem in Deutschland, dass ihm nur nicht überzeugend genug erklärt worden ist, Anna stelle für ihn keine Bedrohung dar. Null Toleranz.
Übrigens besucht Anna zweimal im Jahr ihren nach wie vor in Kenia lebenden Vater. Immer wieder wird ihre Mutter gefragt, ob sie keine Angst habe, ihre Tochter dorthin reisen zu lassen. Man lese doch in der Zeitung viel über die dramatisch ansteigende Kriminalität in dem ostafrikanischen Land. Nein, ihre Mutter hat keine Angst. Jedenfalls nicht mehr Angst, als wenn sie ihre Tochter allein mit der U-Bahn zum Zahnarzt an den Potsdamer Platz schickt.
|
|
|
 |
Textanhang zu Aufgabe 3 |
 |
|
Paul Schallück: Unser Eduard
"Er war mein Sohn, mein einziger. Ich begreife es nicht. Sie gehen durchs Haus und flüstern viel, seine Mutter und seine Schwester. Wenn ich heimkomme, verstummen sie. Betrete ich das Zimmer, blicken sie nicht auf. Bei Tisch fällt kaum ein Wort. Sie schweigen mich an, sie strafen mich. Bin ich denn schuld? War ich zu streng? Ich mußte streng sein. Er war sehr begabt, aber verspielt, zu weich; verwöhnt worden von denen, die jetzt schweigen. Als er vierzehn wurde, durfte er mit an die Costa Brava. Von da an übernahm ich seine Erziehung. Er wollte ein Schlauchboot. Ich sagte: Lerne schwimmen, dann bekommst du eins. Er lernte es in einer Woche. So wollte ich ihn vorbereiten auf das Leben. Er mußte begreifen, daß ihm nichts geschenkt wurde. Auch mir hat niemand etwas geschenkt. Das sagte ich ihm, als er sechzehn war, wie ich mich abgemüht, den Betrieb aufgebaut, ihn selbständig erhalten hatte. Für ihn. Er wird stolz sein auf seinen Vater, ihm nacheifern, dachte ich. Die Schule fiel ihm leicht. Wenn er Lust hatte, war er der Beste in seiner Klasse. Nur, er hatte nicht immer Lust. Ein Sonnenstrahl konnte ihn ablenken oder ein Buch, ein Schnupfen schon und erst recht ein Fußballänderspiel. Wie besessen lief er Tag für Tag zum Fußballplatz und vergaß die Schulaufgaben. Ich schloß die Fußballschuhe ein, und er lernte wieder, für ein paar Wochen. Dann begann er, Trompete zu blasen. Er schrieb Gedichte, kletterte in die Berge und sammelte Steine, ersparte und erbettelte sich ein Fernrohr und beobachtete die Sterne in langen Nächten, tauschte das Rohr gegen ein Moped ein, raste durch die Gartenstadt, ließ die Maschine verrosten, malte abstrakt, züchtete Fische. Alles für ein paar Wochen. So wechseln viele Jungen ihre Neigungen, ich weiß. Er aber vergaß darüber seine Pflichten. Er wurde siebzehn und achtzehn und hatte noch immer nicht gelernt, sich zu konzentrieren. Dann entdeckte er die Mädchen und kam zum ersten Male mit einer Fünf nach Haus. Nach jeder erloschenen Begeisterung redete ich ihm ins Gewissen, drohte, kürzte sein Taschengeld, sperrte den Ausgang, nahm ihn während der Osterferien in den Betrieb, ins Labor. Wenn ich ihn ins Gebet nahm, sah er ein, wie fahrig er dahinlebte, jedem Winde nach, und versprach, härter zu werden. Wenn ich ihn strafte, weinte er; ein aufgeschossener, achtzehnjähriger Bursche. Im letzten Sommer dann fuhr seine Mutter und seine Schwester allein an die Costa Brava. Ich blieb mit ihm zu Haus. Wir erarbeiteten einen Stundenplan, und ich erklärte: Deine letzte Chance, Eduard; wirst du nicht in die Oberprima versetzt, nehme ich dich von der Schule. Ein Ultimatum. Ob ich es wahr gemacht hätte, weiß ich nicht. Ihn jedenfalls hat es erschreckt, ich gebe es zu. Aber durfte ich ihn nicht einschüchtern? Wie hätte er sonst ein tüchtiger Mensch werden können und das Leben bestehen? Mußte ich denn voraussehen, daß es ihn zermürben würde? Bin ich deswegen schuld an deinem Tod, Eduard? Ich kann es nicht glauben. Du warst ungezügelt von Natur aus, du konntest dich nicht beherrschen. Es war eine Kurzschlußhandlung. Eduard. Ein paar schlechter Noten wegen springt man nicht von der Brücke. Dafür wirft man doch sein Leben nicht weg, Eduard, mein Junge!"
"Edi war mein Junge, mein einziger Sohn, und er war ein guter Junge, das schwöre ich zu Gott, denn wer sollte das besser beurteilen können als ich, seine Mutter, die er verlassen hat, weil er mit einer unergründbaren Leidenschaft eigensinnig war und etwas suchte, schon als kleiner Junge, denn schon als kleiner Junge wollte er alles oder nichts. So war er veranlagt, mein Edi, nicht anders: Alles oder nichts. Wenn sein Vater meint, er sei von Natur aus ungezügelt gewesen und habe sich die neunzehn Jahre seines Lebens nur gehen lassen und sich niemals konzentrieren können, wie es wohl den Anschein haben mochte, wenn man ihn von einem festen Standpunkt aus beobachtete, oder was sein Vater sich sonst noch bereitgelegt hat, um das Ungeheuere zu erklären, dann kann ich nur sagen: Sein Vater folgt einer falschen Spur. Edi war ein ernster Junge, viel zu ernst sogar für sein Alter, und er war es von Kind an, ich habe ihn nur selten lachen gesehen, denn, obwohl es schien, als flattere er jedem Winde nach, war er doch jedesmal mit einem Ernst am Werk, der mich besorgt und ihn besessen machte. Er suchte etwas, von dem ich lange nicht ahnte, was es war, bis er eines Tages, er mochte zehn gewesen sein oder elf, aus der Kirche kam und sagte, sehr ernst, aber ohne ein Zeichen der Erregung: Weißt du, Mutter, ich könnte mir das Leben nehmen. Ich war verblüfft und erschrocken und habe ihn ausgelacht, so daß er wütend wurde und mich anfuhr: Lach nicht, lach nicht, ich könnte mir wirklich das Leben nehmen! Aber warum denn, mein Junge, fragte ich dann endlich. Und er blickte mich an wie ein sehr alter Mann: Um zu wissen, wer Gott ist, sagte er. Ich hatte das vergessen. Jetzt sehe ich ihn wieder vor mir und höre ihn sprechen, und ich glaube fest, daß er wahrgemacht hat, worüber ich gelacht habe. Mit Verbissenheit hat er gesucht, sein Leben lang und überall, einen Halt meinetwegen, wenngleich ich behaupte: Er hat Gott gesucht, überall, in seinen Gedichten so gut wie auf dem Fußballplatz, in der Geschwindigkeit seines Mopeds und in den Steinen und unter den Sternen und in der Farbe und unter den Fischen und in der Musik. Auch bei den Mädchen. Gesucht und gesucht und doch nicht recht gewußt, was er zu finden hoffte in all dem, was ihn reizte und so rasch hinter ihm zurückblieb, ausgelaugt und weggeworfen, weil er nicht fand, was er suchte, und da er sich vermutlich des Satzes nicht erinnerte, den ich ihn noch immer sprechen höre. Die schlechten Noten haben damit wenig zu schaffen. Denn am Morgen hatte der Mathematiklehrer ihnen das Einsteinsche Weltbild erklärt und gesagt, die Welt sei endlos, aber nicht unbegrenzt oder so ähnlich, und Edi hatte zugehört wie einem neuen Evangelium und dann mit kalter Stimme gefragt, wo denn in dieser Welt Gott noch seinen Platz habe, und der Mathematiklehrer hatte ihn lächelnd an den Religionslehrer verwiesen, und am Mittag dann hat er sich von den Schulkameraden gelöst und ist allein zur Brücke gegangen und hat das Letzte versucht, um zu finden, was er suchte. Du wolltest alles oder nichts, Edi, mein Junge, aber das war nicht richtig, es läßt sich ja nicht zwingen, ein bißchen Demut hat dir gefehlt und ein bißchen Vertrauen zu deiner Mutter, warum bist du nicht zu mir gekommen, Edi, warum nicht, warum denn nicht zu deiner Mutter, Edi?"
"Ed, mein kleiner Bruder, war ein Junge wie andere, ein bißchen begabter vielleicht und feiner gesponnen, das war aber auch der einzige Unterschied. Er spielte gern, saß gern auf einer schnellen Maschine, wechselte seine Hobbys, tat alles, was andere Jungen tun. Er war ja viel jünger als seine Jahre. Erst als er den Mädchen begegnete, begann seine Not. Er war prächtig gewachsen, der Ed, und er konnte an jeder Hand zehn haben und hatte sie auch. Nur, er war nie zufrieden. Was sie ihm gaben - und das war nicht wenig, es war alles in ihren Augen -, es genügte ihm nicht. Er verlangte mehr, Liebe verlangte er, obwohl er selbst es vermutlich nicht wußte, das Wort jedenfalls gebrauchte er nie. Liebe von Mädchen, die nicht wissen, was das ist. Daran ist er zerbrochen. Er war ja noch nicht ausgereift, geistig, meine ich. In seiner Klasse gab es zwei Mädchen. Die kicherten, als ihm mitgeteilt wurde, es sei nicht sicher, ob er mit den schlechten Noten versetzt werden könne. Das Kichern war sein Verhängnis. Wir achten zu selten auf die kleinen Dinge, ein Wort, einen Blick, eine Geste oder ein Kichern, besonders in Eds Jahren. Die Mädchen haben ihn auf dem Gewissen, aber sie wissen es nicht. Unschuldig wie kleine Tiere."
"Unsinn. Mein Freund Eddi, mit doppeltem D, der suchte nicht mehr, nirgendwo und nichts, der ließ sich von einem Kichern nicht umwerfen. Der
hatte längst gefunden. Er wußte, was er wollte, wie wir alle. Der wußte längst, daß alles keinen Sinn hat. Er probierte
noch ein bißchen, mal hier, mal da. Aber es war gleichgültig, ob er auf dem Moped lag oder auf einem Mädchen. Es interessierte ihn
so lange, wie es dauerte. Dann war's vorbei und langweilte ihn. Ich bin genauso, darum weiß ich es. Was er anfaßte, gelang, aber es
machte ihm keinen Spaß. Es hat doch alles keinen Sinn. Was soll das alles? Die schlechten Noten hätte er bis zur Versetzung mit der linken
Hand korrigiert. Daß er's an diesem Tag getan hat, war nur, um die Alten auf die falsche Spur zu locken. Der beste Schüler der Klasse verübt
Selbstmord ein paar schlechter Noten wegen. Das ist paradox, das liebte er. Ich beneide ihn, weil er härter war als wir alle, weil er den Mut gehabt
hat, wozu ich nie den Mut haben werde. So war unser Eddi, mit doppeltem D."
Paul Schallück, Unser Eduard, In: Willi Fehse (Hrsg.), Deutsche Erzähler der Gegenwart, Stuttgart 1959, S. 185-188.
|
|
|
 |
Textanhang zu Aufgabe 4 |
 |
|
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781):
Nathan der Weise (II. Akt, 5. Szene)
Vorbemerkung:
"Nathan der Weise" spielt zur Zeit des 3. Kreuzzuges (l 189-1192) in Jerusalem, der heiligen Stadt der Juden, Christen und Moslems. Von einer Geschäftsreise zurückgekehrt, erfährt der Jude Nathan, dass seine Tochter Recha durch einen christlichen Ritter vom Orden der Tempelherren vor dem Feuertod gerettet worden ist.
F ü n f t e r A u f t r i t t
Nathan und bald darauf der Tempelherr
NATHAN:
Fast scheu' ich mich des Sonderlings. Fast macht
Mich seine rauhe Tugend stutzen. Daß
Ein Mensch doch einen Menschen so verlegen
Soll machen können! - Ha! - er kömmt. - Bei Gott!
Ein Jüngling wie ein Mann. Ich mag ihn wohl,
Den guten, trotz'gen Blick! Den prallen Gang!
Die Schale kann nur bitter sein: der Kern
Ist's sicher nicht. - Wo sah' ich doch dergleichen? -
Verzeihet, edler Franke ...
TEMPELHERR: Was?
NATHAN: Erlaubt...
TEMPELHERR:
Was, Jude? Was?
NATHAN: Daß ich mich untersteh', Euch anzureden.
TEMPELHERR: Kann ich' s wehren? Doch Nur kurz.
NATHAN: Verzeiht, und eile nicht so stolz, Nicht so verächtlich einem Mann vorüber, Den Ihr auf ewig Euch verbunden habt.
TEMPELHERR:
Wie das? - Ah, fast errat' ich's. Nicht? Ihr seid...
NATHAN:
Ich heiße Nathan; bin des Mädchen Vater, Das Eure Großmut aus dem Feu'r gerettet; Und komme...
TEMPELHERR:
Wenn zu danken: - spart's! Ich hab' Um diese Kleinigkeit des Dankes schon Zu viel erdulden müssen. - Vollends Ihr, Ihr seid mir gar nichts schuldig. Wußt' ich denn, Daß dieses Mädchen Eure Tochter war? Es ist der Tempelherren Pflicht, dem ersten, Dem besten beizuspringen, dessen Not Sie sehn. Mein Leben war mir ohnedem In diesem Augenblick lästig. Gern, Sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, Es für ein andres Leben in die Schanze Zu schlagen: für ein andres - wenn's auch nur Das Leben einer Jüdin wäre.
NATHAN: Groß!
Groß und abscheulich ! - Doch die Wendung läßt Sich denken. Die bescheidne Größe flüchtet Sich hinter das Abscheuliche, um der Bewundrung auszuweichen. - Aber wenn Sie so das Opfer der Bewunderung Verschmäht. Was für ein Opfer denn verschmäht Sie minder? - Ritter, wenn Ihr hier nicht fremd, Und nicht gefangen wäret, würd' ich Euch So dreist nicht fragen. Sagt, befehlt: womit Kann man Euch dienen?
TEMPELHERR: Ihr? Mit nichts.
NATHAN: Ich bin Ein reicher Mann.
TEMPELHERR: Der reichre Jude war Mir nie der beßre Jude.
NATHAN: Dürft Ihr denn Darum nicht nützen, was dem ungeachtet Er Beßres hat? Nicht seinen Reichtum nützen?
TEMPELHERR:
Nun gut, das will ich auch nicht ganz verreden; Um meines Mantels willen nicht. Sobald Der ganz und gar verschlissen; weder Stich Noch Fetze halten will: komm' ich Und borge mir bei Euch zu einem neuen, Tuch oder Geld. - Seht nicht mit eins so finster! Noch seid Ihr sicher; noch ist's nicht so weit Mit ihm. Ihr seht; er ist so ziemlich noch Im Stande. Nur der eine Zipfel da Hat einen garst'gen Fleck; er ist versengt. Und das bekam er, als ich Eure Tochter Durchs Feuer trug.
NATHAN der nach dem Zipfel greift und ihn betrachtet: Es ist doch sonderbar, Daß so ein böser Fleck, daß so ein Brandmal Dem Mann ein beßres Zeugnis redet als Sein eigner Mund. Ich möchte' ihn küssen gleich -Den Flecken! - Ah, verzeiht! - Ich tat es ungern.
TEMPELHERR: Was?
NATHAN: Eine Träne fiel darauf.
TEMPELHERR: Tut nichts! Er hat der Tropfen mehr. - (Bald aber fängt Mich dieser Jud' an zu verwirren.)
NATHAN: Wär't Ihr wohl so gut, und schicktet Euern Mantel Auch einmal meinem Mädchen?
TEMPELHERR: Was damit?
NATHAN: Auch ihren Mund an diesen Fleck zu drücken. Denn Eure Kniee selber zu umfassen, Wünscht sie nun wohl vergebens.
TEMPELHERR: Aber, Jude - Ihr heißet Nathan? - Aber, Nathan - Ihr Setzt Eure Worte sehr - sehr gut - sehr spitz - Ich bin betreten - Allerdings - ich hätte...
NATHAN:
Stellt und verstellt Euch, wir Ihr wollt. Ich find' Auch hier Euch aus. Ihr wart zu gut, zu bieder, Um höflicher zu sein. - Das Mädchen, ganz Gefühl; der weibliche Gesandte1), ganz Dienstfertigkeit; der Vater weit entfernt - Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge; Floht ihre Prüfung; floht, um nicht zu siegen. Auch dafür dank' ich Euch -
TEMPELHERR: Ich muß gestehn, Ihr wißt, wie Tempelherren denken sollten. NATHAN: Nur Tempelherren? sollten bloß? Und bloß; Weil es die Ordensregeln so gebieten? Ich weiß, wie gute Menschen denken; weiß, Daß alle Länder gute Menschen tragen.
TEMPELHERR:
Mit Unterschied, doch hoffentlich?
NATHAN: Ja wohl; An Färb', an Kleidung, an Gestalt verschieden.
TEMPELHERR:
Auch hier bald mehr, bald weniger, als dort.
NATHAN:
Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her, Der große Mann braucht überall viel Boden; Und mehrere, zu nah gepflanzt, zerschlagen Sich nur die Äste. Mittelgut, wie wir, Findt sich hingegen überall in Menge. [...]
TEMPELHERR:
Sehr wohl gesagt! - Doch kennt Ihr auch das Volk, Das diese Menschenmäkelei zu erst Getrieben? Wißt Ihr, Nathan, welches Volk Zu erst das auserwählte Volk sich nannte? Wie? wenn ich dieses Volk nun, zwar nicht haßte, Doch wegen seines Stolzes zu verachten, Mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes; Den es auf Christ und Muselmann vererbte, Nur sein Gott sei der rechte Gott! - Ihr stutzt, Daß ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede? Wenn hat, und wo die fromme Raserei, Den bessern Gott zu haben, diesen bessern Der ganzen Welt als besten aufzudringen, In ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr Gezeigt als hier, als itzt? Wem hier, wem itzt Die Schuppen nicht vom Auge fallen ... Doch Sei blind, wer will! - Vergeßt, was ich gesagt; Und laßt mich! Will gehen.
NATHAN: Ha! Ihr wißt nicht, wieviel fester Ich nun mich an Euch drängen werde. - Kommt, Wir müssen, müssen Freunde sein! - Verachtet Mein Volk so sehr Ihr wollt. Wir haben beide Uns unser Volk nicht auserlesen. Sind Wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, Als Mensch? Ah! Wenn ich einen mehr in Euch Gefunden hätte, dem es gnügt, ein Mensch Zu heißen!
TEMPELHERR: Ja, bei Gott, das habt Ihr, Nathan! Das habt Ihr! - Eure Hand! - Ich schäme mich Euch einen Augenblick verkannt zu haben.
NATHAN:
Und ich bin stolz darauf. Nur das Gemeine Verkennt man selten.
TEMPELHERR: Und das Seltene Vergißt man schwerlich. - Nathan, ja; Wir müssen, müssen Freunde werden.
NATHAN: Sind Es schon. - Wie wird sich meine Recha freuen! -Und ah! Welch eine heitre Ferne schließt Sich meinen Blicken auf! - Kennt sie nur erst!
TEMPELHERR:
Ich brenne vor Verlangen - Wer stürzt dort Aus euerm Hause? Ist's nicht ihre Daja?
NATHAN:
Jawohl. So ängstlich?
TEMPELHERR: Unsrer Recha ist Doch nichts begegnet?
1) Daia, Christin und Gesellschafterin von Recha
|
|
|
|